Servus beinand,
anlässlich des Geburtstags meiner Frau Sonja haben wir zu
dritt (Sonja, Hündin Tapsie und ich) einen mystisch-geschichtlichen Ausflug
nach Leutstetten gemacht, auf den wir euch alle mitnehmen wollen. Vorweg sei
gesagt, dass ich nicht esoterisch angehaucht bin, also nicht an Geister, Hexen,
Göttinen und Ähnliches glaube, aber viele Mythen haben einen wahren Kern… Ich möchte euch auf unseren Ausflug in die Welt der Magie und der Mythen mitnehmen. Der Ausflug ist etwas textlastig, da ich einige Eindrücke beschreiben möchte.
Jedenfalls haben wir das besucht, was in der Esoterik als „Kraftorte“
bezeichnet wird. Für mich ist eigentlich jeder ursprüngliche Wald ein Kraftort.
Wer kann sich der Faszination entziehen, den ein echter Urwald ohne
menschlichen Einfluss auslöst? Doch hier geht es um ganz spezielle Kraftorte.
Leutstetten ist doppelt berühmt – einerseits wegen der
seltenen Pilzarten, die dort zu finden sind (und einem wunderschönen
Naturwaldreservat) – andererseits wegen der Heiligen Orte des Würmtals bzw. dem
als Mühltal bezeichneten Abschnitts. Der Sage nach soll sogar Karl der Große
dort geboren worden sein – in der Karlsburg, von der nur noch allerletzte Reste
vorhanden sind.
Doch sehr lange vor Karl dem Großen war das Mühltal ein Ort
der Kelten (bevor dann die Römer kamen und ebenfalls dort siedelten). Ein
Zeugnis dessen ist ein Hügelgrabfeld, welches – nicht mehr sehr idyllisch –
direkt an der S-Bahn-Linie zu finden ist. Die Hügelgräber sind auffallend groß
und jedes einzelne wurde aufgegraben und entleert. Die Grabbeigaben lassen
vermuten, dass es sich um höhergestellte Persönlichkeiten handelte, die dort begraben
wurden.

So sehen diese Hügelgräber aus - im Wald, völlig vergessen und allesamt aufgegraben, also leer.

Da ich nicht pietätlos sein möchte, bin ich nur deshalb in das Grab gesteigen, weil ich ja weiß, dass es leer ist. Ich darf übrigens vorstellen: Tapsie (die Dame in weiß - der Kamerataschenträger bin ich)
Ein Grab enthielt aber eine Besonderheit – ein Frauenskelett
mit einem symbolischen Rad als Schmuckstück. Das Rad ist das Symbol der Wilbet,
auch Vilbeth, Willbet, Firbet genannt. Auch dieses Grab ist natürlich leer. Es ist besonders groß und man sieht es schon von weitem:

Ich habe auch mal gelesen, dass das
englische Wort „wheel“ von dem Namen dieser Göttin / Seherin / magischen Frau
stammen soll. Das Skelett wurde von Julius Naue (1832-1907) ausgegraben – er hat
offenbar das gesamte Gräberfeld geplündert – äh, nein – archaeologisch bearbeitet.
Im zweiten Weltkrieg wurde das Skelett und die Grabbeigaben nach Berlin
verfrachtet und sind seitdem verschollen.
Aufgrund des Radschmucks entstand die Interpretation, dass
dieses Hügelgrab das Grab der Firpet / Wilbet sei und wird daher hier als das
Grab der Seherin bezeichnet. Dementsprechend wird dem Grab, obwohl es geöffnet
wurde, eine besondere Kraft zugeschrieben. Es finden auch kultische Zeremonien
statt, es werden kleine Opfergaben gebracht (man siehe den Schnuller und das Bärli auf dem Bild) und gerne werden Wunschbänder
aufgehängt.

Und da zeigt sich, dass nicht alle Esoteriker wirklich an
den Wurzeln ihres Tuns interessiert sind, sondern dass viele entweder dumme Trittbrettfahrer
sind oder wirklich so tumb sind… denn die Wünsche sollen sich dann erfüllen,
wenn das Band, welches aufgehängt wurde, verwittert ist und zu Boden fällt. Bei
natürlichen Stoffen passiert das. Die meisten Bänder sind aber aus Plastik.
Sehr beliebt sind Geschenkbänder. Dass die nicht verrotten, hat sich wohl nicht
herumgesprochen – und auch Mikroplastik in der Umwelt ist für diese Esoteriker
wohl kein Thema.



Die Energie, die von dem Grab der Seherin ausgeht, habe ich
ehrlich gesagt nicht gespürt. Im Gegenteil, die Bahnstrecke und ein auf der
anderen Seite verlaufender Radlweg nehme Viel von der Mystik weg. Vielleicht
sollte man mal zu Mitternacht bei Vollmond das Grab besuchen und dort die
Energie in sich aufnehmen?!
Diese Runen wurden in eine Buche direkt neben dem Grab
geritzt:

Die Runen bedeuten buchstabengetreu „Windmein“. Das Pentagramm, das
vor den Runen im Baum geritzt zu finden ist, hat meines Wissens aber keinen
germanischen Ursprung:

Zudem ist die Seherin, um die es geht, Keltin gewesen
und keine Germanin. Warum man dann Runen schnitzt, erschließt sich mir nicht
ganz, aber vielleicht denke ich mit zu viel Logik.
Hier noch ein kleiner Altar, der vielleicht zu kultischen Zwecken genutzt wird oder doch nur reiner Kitsch ist?

Tapsie fand das Hügelgrab eher langweilig und konnte nicht verstehen, warum wir hier so lange geblieben sind...

Direkt am Grab, also auf dem Seitenhang des Grabhügels, fand
ich nämlich Lenzites betulinus, den Birkenblättling (natürlich nicht an Birke,
sondern an Buche) - und das Fotografieren dauert halt ein Bisserl, da braucht Tapsie Geduld.



Zudem – ob es Zufall ist – wachsen hier viele Hexenröhrlinge
– Suillellus luridus wuchs fast überall, selbst direkt im Wegschotter des
Radlwegs / Forstwegs, der durch das Gräberfeld angelegt wurde:







Die
Sommersteinpilze waren leider alle schon durch – nur noch Reste früherer
Pracht, daher aus Pietätsgründen kein Foto.
Doch weiter auf unserem Ausflug… zur drei-Bethen-Quelle
(oder auch drei-Beten-Quelle geschrieben). Die Sage um die drei Beten prägt in
der Tat das Mühltal. Mitten in der „radikalchristlichen“ Zeit, um 1643, als
noch Scheiterhaufen brannten und der 30-jährige Krieg noch tobte, wurde in der
Einbettl-Kapelle (Einbettl kommt von Einbet / Einbeth / Ainbeth / Ainpet, ein
Name der drei Beten) ein Gemälde der drei Beten zur Anbetung platziert. Das
Kuriose: die drei Beten werden mit ihren heidnisch-keltischen Namen genannt:
Ainpet, Gberpet und Firpet (Einbeth, Warbeth, Wilbeth) und angegebet. Das „S“
vor dem Namen, welches „Sankt“ bdeuetet, macht aus den dreien einfach und
schnell drei christliche Heilige. Das zeigt aber, wie lange sich die keltisch-religiöse
Vergangenheit trotz des Christentums, das teils sehr radikal gegen heidnische
Bräuche vorging, gehalten hat. Die Anbetung dreier Frauen passte allerdings
nicht in das männliche christliche Weltbild, in dem Frauen als vom Teufel
verführbar und verderbt galten (man denke an die Interpretation des Wortes
femina zu fe mina / fe minus, weniger Glaube im Hexenhammer).
Doch zurück ins Mühltal… Auf einer Linie zwischen der
Einbettl-Kapelle und dem Grab der Seherin finden sich die 3-Bethen-Quelle. Hier
tritt kurz oberhalb der Würm ein kleines Rinnsal aus dem Kalkstein einer
Endmoräne der Würmkaltzeit.

Ich kenne diese Quelle schon sehr lange, denn wenn
man hier spazieren geht, fallen wieder die Gebets- und Wunschbänder auf. Es
ging früher das Gerücht um, dass hier nachts zu Vollmond Hexen nackt an der
Quelle tanzen. Ein anderes Gerücht besagt, dass die Quelle heilende Eigenschaften
besitzt, vor allem gegen Augenleide.
Früher hatten viele Starnberger eine kleine Radtour zu
Quelle gemacht und sich Wasser in Kanister abgefüllt, um es als Heilwasser zu
trinken. Zum leichtern Abfüllen wird das Rinnsaal dann durch ein Rohr geleitet:

Es gab sogar für Autofahrer einen Karrenwagen mit Kanistern, damit man
mit diesem zur Quelle gehen kann, sich das Wasser nimmt und am Auto umfüllt.
Mittlerweile finden sich Warnschilder des Gesundheitsamts, dass das Wasser kein
Trinkwasser sei und zu viele Colibakterien zu finden seien…
Früher galt es als Trinkwasser und wurde auch auf den
Mineralgehalt untersucht. Es enthält unter anderem etwas Schwefel und schmeckt
süßlich. Ich hatte es früher auch ab und zu direkt von der Quelle getrunken, da
es erfrischend kühl an heißen Sommertagen wirkt.
Auch an der drei-Bethen-Quelle trifft der christliche Glaube
auf Naturmystik und Heidentum – es wurde u.a. eine Marienstatue aufgestellt:

Schön, wenn Religionen friedlich koexistieren können und man sich nicht mehr
gegenseitig die Schädel einschlägt, weil jeder meint, der andere Gott sei der
falsche Gott und wer an falsche Götter glaube, müsse sterben.
Und wieder die üblichen Bänder, von Plastik an einer Stange (und einer Werbebroschüre einer schweizer Esoterikerin - sah jedenfalls so aus, habe es nicht durchgelesen)...

... bis hin zu echten Stoffbändern und zu tibetanischen Tüchern...



Nun, auch hier an der Quelle stellte sich kein Gefühl der
Mystik ein, denn sie liegt auf einem der Hauptradlwege zwischen München und
Starnberg. Viele Radler radln verbissen, weil da eben ein Weg ist und schauen
weder nach links oder rechts. Und wenn man zu zweit nebst Hund extra Platz
macht, schaffen es die meisten nichtmal, ein Danke rauszubringen oder gar nur
zu nicken oder zu lächeln. Nein, für Höflichkeiten, Begrüßungsformeln oder
einfach nur Nettigkeit ist da kein Platz. Radln in der Natur ist ja kein Spaß,
das ist eine Aufgabe – der Tacho misst, das Fitnessarmband nimmt auf – und man
muss ja sei Pensum schaffen. Traurig irgendwie. Dabei wäre gerade diese Quelle
eine Möglichkeit, mal komplett zu entschleunigen. Vielleicht liegt es auch an
der Gegend – bei mir in Mammendorf grüßt man sich noch im Wald, wenn man sich
begegnet. Und als ehemaliger Tutzinger weiß ich, wie sich ein Dorf verändern
kann, wenn nur eine sich als reiche Oberschicht fühlende Klientel zuzieht und
die einheimischen wegziehen. Und diese Oberschicht muss nicht grüßen (aber auch
da gibt es natürlich Ausnahmen, man sollte nie zu sehr pauschalisieren). Es
fällt nur sehr auf. Vielleicht liegt es auch am Münchner Einfluss – anonyme
Großstadt…
Wie auch immer, wir haben die Quelle verlassen – wobei es
eigentlich drei Quellen sind. An der ersten stehen normale Bäume, an der
zweiten ein Baum mit Zwiesel (zwei Stämme, in bodennähe verzweigend) und an der
dritten Quelle ist eine Esche mit drei Stämmen zu finden. Die Bäume sind aber
noch recht jung, die Zahlenmystik kann daher noch nicht alt sein. Oder
vielleicht doch kein Zufall?
Die eigentlich letzte Station war nun die Einbettl-Kapelle
in Petersbrunn (hier mit Sonja, dem Geburtstagskind, und Tapsie):

Der Name sagt es schon, auch hier ist eine Quelle. Und hier
wurde das oben erwähnte Gemälde der drei Beten aufgehängt. Esoteriker sagen, es
sei wieder ein Kraftort und die Kraft sei zwischen den beiden Buchsbäumen am
Eingang zur Kapelle am größten:

Die Einbettl-Kapelle liegt wie gesagt auf einer
Linie mit der drei-Bethen-Quelle und dem Grab der Seherin.
Neben der Kapelle steht ein Mahnmal, denn hier ging der
Todesmarsch von Dachau entlang.


Die fehlenden Leerzeichen zwingen den Betrachter, aufmerksam zu lesen und so den Text auch in sich aufzunehmen. Der Rost vermittelt die Trostlosigkeit dieses Todesmarschs. Ein, wie ich finde, gelungenes Mahnmal. Schade, dass die Raser, auf die ich gleich eingehen werde, selbst hier nicht vom Pedal gehen - oder gar mal anhalten, um sich weiterzubilden oder der Toten zu gedenken, die auch hier ihr Leben ließen.
Am Kriegsende wurden 7000 Gefangene aus Dachau
und den umgebenden Todeslagern wie z.B. Kaufering zu Fuß in Richtung Alpen
getrieben. Die Gefangenen durften weder Nahrung aufnehmen noch trinken. Der
Marsch diente als langsame, grausame Hinrichtung. Der Todeszug ging durch das
Mühltal hindurch. Allein der Gedanke daran lässt einen erschauern. Und da ich
einen der Überlebenden des Todesmarsches persönlich erleben durfte (als
Zeitzeuge bei mir an der Schule), habe ich zudem einen kleinen persönlichen
Bezug zu diesem Beispiel menschlicher Unmenschlichkeit.
Zurück zu Kapelle… sie steht auf einer Quelle (jetzt hört
man nur noch Wasser unter einem Gullideckel rauschen), die ebenfalls durch den
Mineralgehalt und den enthaltenen Schwefel als Heilquelle galt. Es wurde hier
sogar ein eigenes Heilbad erbaut, welches mittlerweile komplett der Straße, die
durch das Mühltal geht, weichen musste:
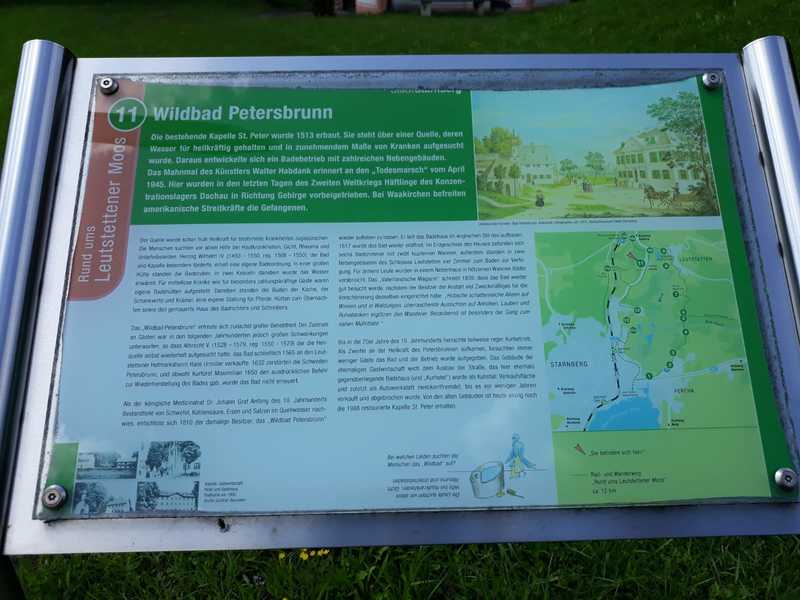
Statt Ort der Ruhe, Entspannung und des
Heilbades rasen Autos und Motorräder vorbei. Es ist zwar Tempo 40
ausgeschildert, aber wer hier mit dem neusten Sportwagen angeben will, muss auf
120 hochbeschleunigen. Und was wäre das ruhige Mühltal ohne hochtourigen Motorrad-Lärm?
Da tun mir die Esoteriker eigentlich sehr leid, die hier Orte der Kraft suchen.
Oder nur Orte der Ruhe, inneren Einkehr, Besinnung und Meditation. Der nächste
Porsche oder Jaguar beenden diese Hoffnung. Ich empfehle mal, die Straße selber
zu fahren und sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu halten. Dann
erzeugt dieser Ort der Stille pure Aggression bei manchen Sportwagenfreunde.
Hauptsache hoher Spritverbrauch und lauter Motor – dazu enge Kurven, Wanderer,
Spaziergänger – ideal, um rücksichtsloses Verhalten zu zeigen und mit den ach
so tollen und teuren Autos zu protzen. Dass die Straße an einem wirklich tollen
Naturwaldreservat vorbei führt und dass in der Würm Flutender Hahnenfuß weiße
Blütenteppiche erzeugt, kann man so nicht erleben. Dafür möglichst viel Benzin
verbrennen, damit es nächsten Sommer wieder schön warm wird.
Unser kleiner Ausflug ist fast zu Ende. Leider ist die
Kirche St. Alto in Leutstetten, in dem das Gemälde der drei Beten jetzt hängt, verschlossen. Schade,
sonst hätte ich das noch zeigen können.
Dafür sind wir am Ende dann zu einem „meiner Tempel“ gefahren.
Einem kleinen Stückerl Wald zwischen der Straße und der Würm, der reicht an
seltenen Arten ist (z.B. Rubroboletus rhodoxanthus, Rubroboletus
rubrosanguineus, Suillellus mandax – natürlich neben S. luridus – Caloboletus radicans,
Ramaria formosa s.str. usw.). Ein bisserl was hat sich auch hier gezeigt. Und
mit diesen Pilzen beschließe ich unseren Ausflug in die Welt der Magie, der
Mythen und der Hexen(röhrlinge).
Russula olivacea, der bekannte und berühmt-berüchtigte Rotstielige Ledertäubling:




Dann Russula fageticola, ein Doppelgänger von Russula nobilis (R. mairei), der aber häufiger als Russula nobilis ist:



Stiel etwas ockerlich fleckend

(starke Guajak-Reaktion, was ihn makroskopisch direkt - abgesehen vom Habitat - von Russula silvestris unterscheidet)
Und zu guter Letzt der Rosahütige Röhrling, Rubroboletus rhodoxanthus, noch als Baby und noch gelben Poren:


Liebe Grüße und danke für’s mitgehen,
Christoph


