Letztes Wochenende waren wir mal wieder zum Pilzesuchen im
Breesener Moor in Nordwestmecklenburg – wir, das sind Torsten Richter (TR),
Vorsitzender des Rehnaer Pilzvereins, und ich (CE), einfacher Freizeitmykologe aus
Lübeck. Mal wieder heißt, wir hatten dieses Gebiet in den letzten drei Jahren
schon 15mal gemeinsam aufgesucht, um die dortige Pilzwelt zu erkunden. Da das
Torfabbaugebiet aktuell immer noch gemanagt wird, führen Änderungen der Wasserstände
und größere Erdbewegungen immer wieder auch zu Änderungen in der Pilzflora. Bisher
gab es bei unseren zwei- bis dreistündigen Exkursionen fast immer ganz besondere
und überraschende Pilzarten zu entdecken – und auch dieses Mal, Ende November bei
feucht-milder Witterung, sollte sich das Breesener Moor wieder als Highlight
und Hotspot für ganz besondere Pilze erweisen!

Breesener Moor im November. Foto: CE
Schon auf dem kurzen Fußweg von der Straße ins Moor fällt
uns rechter Hand ein größerer Bestand
Beinwell auf – Torsten hatte schon im Kopf, was dort vielleicht zu finden sein
könnte. Und tatsächlich, schon nach ein oder zwei Minuten gezielter Suche an
der Basis der Beinwellpflanzen finden wir beide zeitgleich die gesuchte
Kostbarkeit: Hemimycena candida, einen hübschen kleinen Scheinhelmling, der an
Wurzeln von Beinwell wächst.

Hemimycena candida an Beinwell. Foto: CE
Auch die weiteren zweihundert Meter zum Moor sind wir
versucht anzuhalten, weil zum Beispiel links aus der Hecke frische Judasohren
leuchten, ein kräftiger Feuerschwamm zum Anschauen einlädt und an
herabgefallenen Blättern und Zweigen so manche Kleinpilze zu vermuten sind –
aber wir wollen ja weiter, ins Moor, und hoffen dort in speziellen Habitaten
und an besonderen Substraten wieder ungewöhnliche Pilze zu finden.
Gleich zu Beginn fallen uns zwischen liegenden Juncus-Stängeln
und auf torfigem Boden scharenweise kegelige Helmlinge auf – die nehme ich zur
näheren Bestimmung mit. Die mikroskopische Untersuchung zu Hause zeigt, daß es
sich tatsächlich um den „Kegeligen Helmling“. Mycena metata handelt. Dessen
igelige Zystiden sind unter dem Mikroskop ein optisches Leckerli !
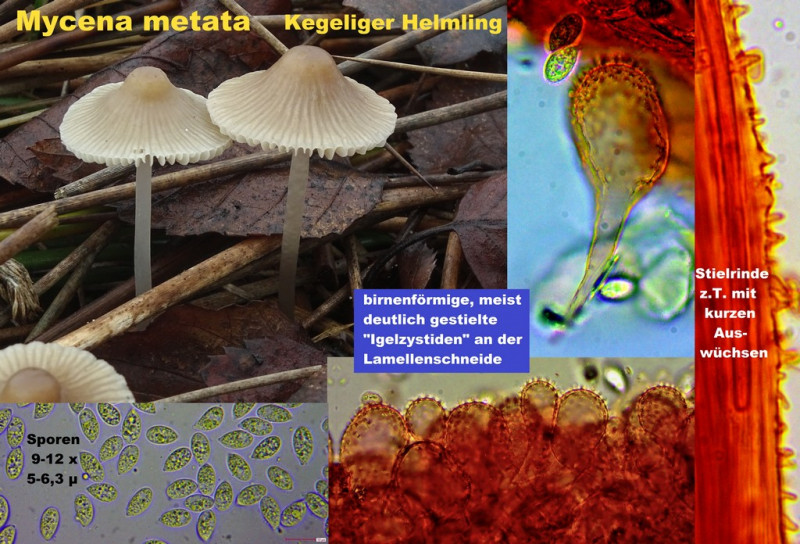
Mycena metata mit Mikromerkmalen. Fotos: CE
Die überall feucht liegenden Stängel haben aber noch mehr zu bieten: auf alten Juncus-Stängeln
wächst eine Hypocrea, offenbar mit grünen Sporen. Auch diese Arten sind
mikroskopisch sehr interessant, weil sie 16-sporige Asci aufweisen. Nach einem
im Internet gefundenen Schlüssel lande
ich bestimmungstechnisch bei Hypocrea spinulosa. Ob das aktuell so (noch)
stimmt, weiß ich nicht, denn wie so mancherorts hat sich taxonomisch und
artentechnisch bei den Hypocreales in letzter Zeit doch einiges getan!

Hypocrea spinulosa auf Juncus. Foto: CE
Sehr hübsch anzusehen sind im moorigen Gelände die
zahlreichen Torfmoos-Schwefelköpfe Hypholoma elongatum, von denen ich
sicherheitshalber auch einige zur Bestimmung einsammle.

Hypholoma elongatum mit Mikro-Merkmalen. Foto: CE.
Unter den kleineren
Arten erfreuen mich noch auf einem von Torsten aufgehobenen Stängel die Fruchtkörper
des Gemeinen Kugelschnellers Sphaerobolus stellatus.

Sphaerobolus stellatus. Foto: CE.
Als in diesem Moment eine rund 20-köpfige
Wildschweinrotte nahe vorbeigallopiert, haben wir den Eindruck, wir sollten unsere Pilzsuche vielleicht
lieber auf der anderen Seite des Moores fortsetzen.
Während auf der Ferne ein Kolkrabe ruft und ein Seeadler vorüberfliegt,
notieren wir im Vorbeigehen noch „Allerweltsarten“ wie Rotrandigen Baumschwamm,
Violetten Knorpelschichtpilz, Schmetterlingstramete, Grünblättrigen
Schwefelkopf und Dickschaligen Kartoffelbovist. Uner Ziel ist ein größerer,
inzwischen durch Entwässerung fast schon trockengefallener Röhrichtbestand, wo
wir in der Vergangenheit schon öfter tolle Funde gemacht haben. Und auch heute
sollten wir nicht enttäuscht werden! Eines der Highlights für mich fand sich
bald an jedem zehnten alten Schilfstängel: dort wuchsen an vorjährigen, feucht
liegenden Schilfblättern in Scharen kleine weiße Schirmpilzchen: Marasmius
limosus, der Schilf-Schwindling, fühlt sich offenbar in genau diesem Habitat
sauwohl.
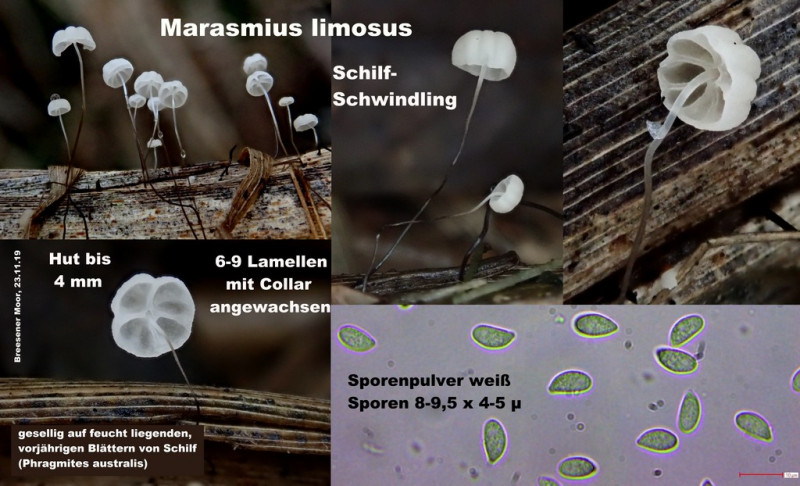
Marasmius limosus an Schilf. Foto: CE
Ein abschließender Gang durch ein kleines Wäldchen am Ein-
bzw. Ausgang des Moores erbrachte dann noch einmal Arten mit ganz anderen Habitatansprüchen.
Am Waldrand zunächst in größerer Zahl auffällige Lacktrichterlinge, die ich zu
Hause aufgrund der breitelliptisch bis subglobosen Sporen von 6,3-9 x 5,9-6,8 µ
und angedeuteter lila Färbung im Schnitt der Stielbasis vorsichtig als Laccaria
bicolor, den Zweifarbigen Lacktrichterling, ansprechen würde. Ihr könnte euch
ja gerne das Foto hier nochmal anschauen:

Die Sporenmaße führen mich hier zu Laccaria bicolor. Foto: CE
Warum ich nicht gleich darauf kam, daß es sich bei dem
auffallenden weißer, auf der Unterseite zwweifarbigen Porling, der
dachziegelartig an einem liegenden Ast wuchs, tatsächlich um den Zweifarbigen
Porling Gelatopora dichroa handelte, muß ich wohl meiner Vergeßlichkeit zuschreiben
– denn die Art habe ich in der Vergangenheit schon mehrmals gesehen. Als
Torsten mir später den Namen verriet, fiel es mir natürlich gleich wieder ein.
Ich meine, daß diese Zweifarbigkeit schon makroskopisch zumindest einen guten
Hinweis auf die Identität des Pilzes gibt!

Gelatopora dichroa. Foto: CE
Und auch der Name eines weiteren, im Feld eigentlich schon
eindeutigen Pilzes fiel uns beiden erst nachträglich ein: bei der Exidia am
Fichtenstamm handelte es sich um Exidia pithya, den
Teerflecken-Drüsling – bei Trockenheit sieht man von dem nur einen schwarzen
Belag, aber jetzt bei dem feuchten Wetter zeigte er sich sehr schön
aufgequollen.

Exidia pithya. Foto: CE
Tja, und das im Wäldchen liegende Totholz erwies sich bei
näherem Hinsehen als alles andere als tot: darauf lebten zahlreiche Arten wie
Mycena speirea, Macrotyphula fistulosa, Chaetosphaerella phaeostroma, der
Winterstielporling Polyporus brumalis und einige andere.
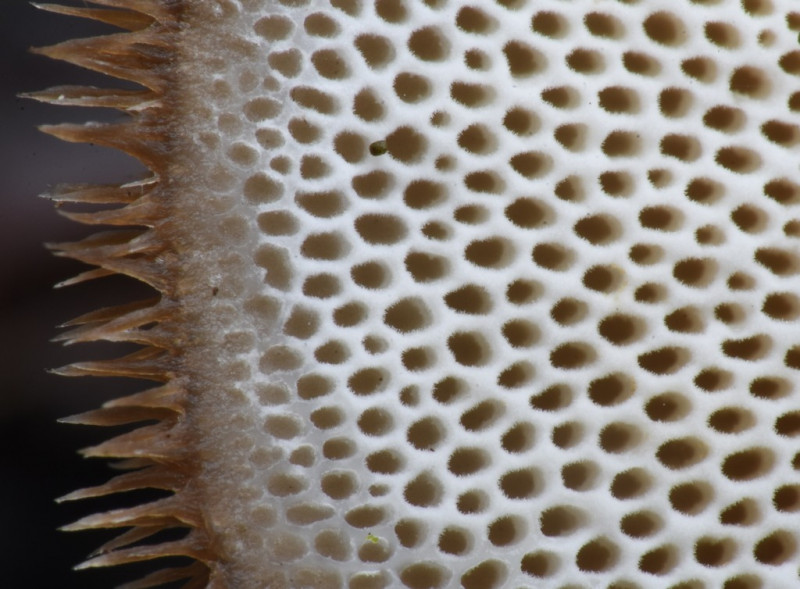
Polyporus brumalis mal in die Poren geschaut. Foto: TR
Torsten, dem es besonders die kleinen Ascomyzeten angetan
haben, findet und bestimmt noch Paorobiliopsis minuta auf harter Birkenrinde.

Paorobiliopsis minuta. Foto: TR
Einige kleine Hutpilze mit kurzem lateralen Stiel kann
Torsten gleich vor Ort als zur Gattung Simocybe gehörig ansprechen. Aber welche
Art? Die Mikromerkmale wie Sporengröße gegen 11 µ, kopfige, an der Spitze maximal
um 6 µ breite Cheilozystiden und das offenbare Fehlen deutlich blasiger
Elemente in der Huthaut führen uns zu Simocybe haustellaris (Simocybe rubi).

Simocybe haustellaris (Simocybe rubi). Foto: TR
Merismodes confusa, der „Wirre Harrschüssselrasen“, läßt
sich nur anhand der Sporenbreite von dem makroskopisch identischen „Gelbbraunen
Haarschüsselrasen“ Merismodes anomala unterscheiden, war also auch etwas für
die Nacharbeit zu Hause.

Merismodes confusa. Foto: CE
Überhaupt kommt die eigentliche Bestimmungsarbeit und viele
Aha-Effekte ja meist erst zu Hause, in den Tagen danach. So schreibt mir
Torsten ein paar Tage später, als die meisten Funde nachbearbeitet und bestimmt
sind, noch von weiteren Knallern: "...habe gerade auf dem Salixast mit Orbilia eucalypti einen Erstnachweis entdeckt: Hyphodiscua theiodeus.... habe ich noch nie gesehen!" Was bei Torsten einiges heißt! Und noch etwas später: "Ich habe gerade noch eine unbeschriebene Art unterm Mikro - aus Breesen natürlich!"
Und dann: „Kein Wunder, wer sammelt in solchen
Biotopen.....nur wir Beide; und dann muß man auch noch die unbeachteten
Substrate beachten..... unsere Wanderung war jedenfalls SUPER.“
Dem ist nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir
uns verabreden: „Auf nach Breesen!“

Chris (re.) & Torsten (li.) im ehemaligen Torfabbaubereich von Breesen. Foto: TR
Sollte jemand Lust bekommen haben, selbst mal in einem
solchen Biotop zu suchen, können wir das nur empfehlen – man findet jedenfalls
andere Arten, als wenn man immer nur im
Wald und auf der Wiese herumkriecht. Und sollte jemandem in diesem Bericht
bemerken, daß uns ein Fehler unterlaufen ist – gerne gleich heraus damit, denn
wir lernen immer noch dazu. Das ist überhaupt das Großartige an der Mykologie:
daß man sie nie völlig ausschöpfen kann, sondern immer wieder Neues findet.
Chris Engelhardt, Lübeck


